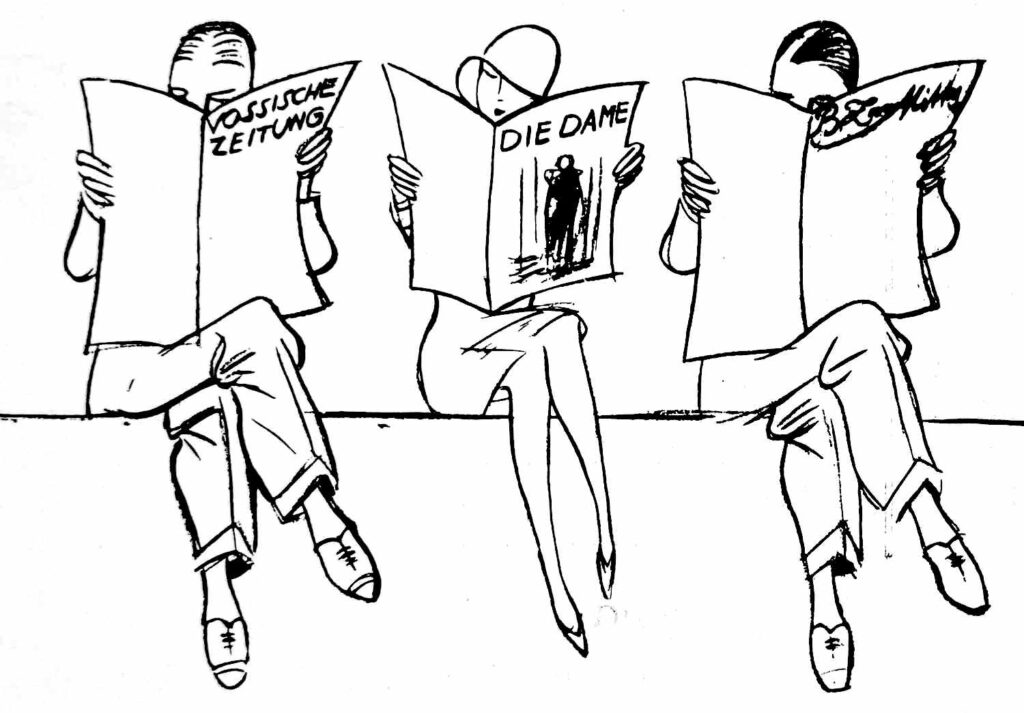
Die letzten Tage der „Tante Voss“
Vor 90 Jahren wurde die älteste Zeitung Berlins eingestellt. Bis zuletzt kämpfte die Redaktion gegen die Gleichschaltung durch die Nazis.
von Michael Bienert
Er sei jetzt „ein freier Mann in des Wortes verwegenster Bedeutung“ schreibt Theodor Heuss im Juli 1933 an einen Freund. Das spätere Staatsoberhaupt ist damals, im Alter von 49 Jahren, ganz unten angekommen – im journalistischen Prekariat. Zuvor war Heuss Redakteur, Reichstagsabgeordneter, Dozent an der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin, doch seit die Nazis an der Macht gelangt sind, bricht alles weg. Er fragt bei Bekannten in Zeitungsredaktionen an, ob sie vielleicht etwas von ihm drucken. Meist bekommt er keine Antwort.
Wenigstens bei der Vossischen Zeitung kann Heuss ein paar Artikel zu historischen Themen unterbringen, dann versiegt auch diese Einnahmequelle. Der letzte Beitrag erscheint am 31. März 1934. Chefredakteur Erich Welter hat bei Heuss den Nachruf auf die Vossische Zeitung bestellt, die an diesem Tag zum letzten Mal erscheint. Der Autor füllt damit in der letzten Märzwoche drei ganze Zeitungsseiten. Mit dem Leser flaniert er durch 300 Jahre Berliner Zeitungsgeschichte, völlig unberührt vom Jargon des Dritten Reiches, der inzwischen auch in den Spalten der „Vossischen“ um sich greift.
Erst ganz am Ende bringt Heuss plötzlich Begriffe „Volk“ und „Gemeinschaft“ ins Spiel. Die nationalsozialistische Idee, die Presse solle eine Gemeinschaft schmieden, findet er abwegig. „Wem aber das nationale Ziel nicht mit einer geistigen Uniformierung zusammenfällt, wer sich das Wissen von der fruchtbaren und bunten Fülle dessen bewahrt hat, was Volk, deutsches Volk, deutscher Geist heißt, mag wohl, indem er von der Vergangenheit dankbar Abschied nimmt, sich des fröstelnden Gefühls einer Verarmung erwehren müssen.“ Dankbar wendet Heuss den Blick zurück auf die Entwicklung des modernen Zeitungswesens, fröstelnd schaut er auf eine Presselandschaft, in der kein Platz mehr für kritischen Journalismus sein soll. Aber, so der trotzige Schluss: „Die Aufgabe ist immer neu gestellt.“
Die Redaktion druckt den Beitrag ohne Verfassernamen. Besser so für Heuss. Die Nazis wissen, dass er 1932 ein warnendes Buch über „Hitlers Weg“ veröffentlicht hat. Und Reichspropagandaminister Joseph Goebbels wäre intelligent genug, die geballte Faust hinter den Heuss´schen Schachtelsätzen zu erkennen.

Der letzte Arbeitstag der Redaktion ist ein Karfreitag. Der Leitartikel des Tages erinnert an die entsetzlich zerschundene Christusfigur auf Grünewalds Isenheimer Altar: „Die Kirche verkündigt nur dann richtig, wenn sie sich bewusst bleibt, dass sie hier auf der Erde nicht die Triumphierende ist und nicht nur die Kämpfende, sondern die in der Nachfolgende Leidende, die Kirche unter dem Kreuz.“ Das ist Sklavensprache, ein kirchenpolitischer Kommentar, zwischen den Zeilen zu lesen. Mit dem Kreuz ist gewiss auch das Hakenkreuz gemeint, das überall in den Straßen hängt. Und die Triumphierenden, das sind die „Deutschen Christen“, die in Hitler einen neuen Heiland sehen. Gleich nach dem Leitartikel wird unter der Überschrift „Das Ringen um den deutschen Glauben“ über sie berichtet. Von einem biozentrischen Weltbild und einer „artgemäßen“ Begründung des Glaubens ist da die Rede, von einer Blut-und-Boden-Ideologie, die „ein neues und sicher echtes religiöses Pathos durchglüht“.
Die letzten gedruckten Seiten der Vossischen Zeitung reserviert die Redaktion für Stimmen aus dem Ausland. „Was von allen und immer und überall geglaubt wurde, hat alle Aussichten, falsch zu sein“, heißt es in den Aphorismen des Franzosen Paul Valéry. Eine Szene des japanischen Dramatikers Kikutij, zwei Gedichten des Russen Serge Jeszenin, Texte von Aldous Huxley und Ortega y Gasset, dann ist Schluss. Die Feuilletonredaktion reißt ihr Fenster zur Welt noch einmal ganz weit auf, ehe es sich für immer schließt.
Wie ist das überhaupt möglich? Von den früheren Redakteuren, meist aus jüdischen Familien stammend, sitzt ja keiner mehr an seinem Schreibtisch. Sie dürfen das Redaktionsgebäude nicht mehr betreten, denn seit dem 1. Januar 1934 gilt das Schriftleitergesetz, das alle Juden vom Journalistenberuf ausschließt und absolute Loyalität zum NS-Staat fordert. Die letzte Redaktion der „Vossischen“ ist eine „kameradschaftliche Arbeitsgemeinschaft“ aus „Nicht-Parteigenossen und alten Nationalsozialisten (Durchschnittsalter der Redakteure 34 Jahre, vorwiegend Frontsoldaten)“ – so verabschiedet sie sich von den Lesern.
Einer der jüngeren Mitarbeiter heißt Raimund Pretzel, er wird später als Sebastian Haffner ein berühmter Publizist: „Ich war hingegangen und hatte zu meiner Freude eine Redaktion gefunden, die ganz und gar nicht Nazi war, die genau so dachte und fühlte wie ich. Es war eine Wonne, in den Redaktionsstuben zu sitzen und zu lästern … Man fühlte sich fast wie in einem Verschwörernest. Und seltsam und beunruhigend war nur, dass das Blatt doch am nächsten Morgen, wenn es herauskam, trotz aller anspielungsgespickten Artikelchen, die man geschrieben und die in der Redaktion so berauscht belacht worden waren, ganz wie ein verständig-überzeugtes Naziblatt wirkte.“
Das Schriftleitergesetz öffnet einigen Nachwuchsjournalisten die Tür, die politisch unbelastet und nichtjüdisch sind. Insgesamt ist seine Wirkung verheerend. Es verdrängt weit über 1000 missliebige Journalisten aus ihrem Beruf. Nur noch Mitglieder der Reichspressekammer, die vom Propagandaministerium kontrolliert wird, dürfen publizieren. Die Leser reagieren unwillig: Binnen eines Jahres sinkt die Gesamtauflage der deutschen Tageszeitungen um die Hälfte.
Mit Schaudern liest man in der Vossischen Zeitung vom 30. März 1934 etwa den Verlautbarungsartikel über „Erb-Auslese durch Ehestandsdarlehen“. Unten auf der Seite erfährt man, wie sächsische Ärzte gegen „erbkranken Nachwuchs“ vorzugehen haben: „Vor allem sollen die Personen, die unfruchtbar zu machen sind, dahin beeinflusst werden, dass sie den Antrag auf Unfruchtbarmachung selbst stellen.“ Daneben die Meldung, 37 Volksschädlingen sei die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen worden, namentlich dem Nobelpreisträger Albert Einstein und den Schriftstellern Johannes R. Becher, Oskar Maria Graf und Theodor Plivier.
Das wollen die Abonnenten der Vossischen Zeitung morgens am Frühstückstisch sicher nicht lesen. Aber die Kontrolle über Inhalte und Redaktionspersonal ist den Verlegern entglitten. Seit Oktober 1933 liegt die Geschäftsführung nicht länger in den Händen der Verlegerfamilie Ullstein. „Nach zwei Monaten Hitler hatte sich unser gut geführtes Haus in ein Schlachtfeld gewandelt. Ein Ort, an dem der Verleger es als seine Pflicht ansah, seinen Prinzipien zu folgen, Übeltäter zu entlarven und Ungerechtigkeiten anzusprechen, war zu einer Mördergrube geworden, in der die ungeheuerlichsten Verbrechen beschwiegen wurden“, schreibt Hermann Ullstein, der jüngste Sohn des Verlagsgründers, in seinen Erinnerungen aus dem amerikanischen Exil. Der modernste und größte Verlagshaus Europas sei bald nur noch ein „Sprachrohr von Knallchargen“ gewesen.
Doch ein großer Teil der Leser bürgerlich-liberaler Zeitungen war nicht bereit, den erzwungenen politischen Richtungswechsel der Blätter hinzunehmen. Glaubt man Hermann Ullstein, dann waren es die massiven Auflageneinbrüche bei allen gleichgeschalteten Zeitungen, die das Aus für die Vossischen Zeitung herbeiführten: „In einer derartig verwüsteten Presselandschaft war ihr Dasein sinnlos geworden.“ Es gab keinerlei wirtschaftliche Perspektive mehr für das Blatt, das schon vor 1933 rote Zahlen schrieb.

Zwanzig Jahre lang war die „Vossische“ ein Verlustgeschäft für die Ullsteins. 1914 übernahm ihr junger, aufstrebender Medienkonzern das gemütliche Familienblatt, um eine moderne Hauptstadtzeitung daraus zu machen. Er pumpte Millionen in einen Relaunch, in ein weltweites Korrespondentennetz, in eine fachlich exquisit besetzte Redaktion. Sogar eine eigene Reichsausgabe wurde produziert, um mit dem überregional beachteten Berliner Tageblatt oder der Frankfurter Zeitung zu konkurrrieren. Aber die Auflage der „Voss“ blieb bescheiden, im Sommer 1933 lag sie werktags bei gut 53.000 Exemplaren. Von der Berliner Morgenpost verkaufte Ullstein 370.000 Zeitungen, am Wochenende fast eine halbe Million. Weit höher war die Auflage von Zeitschriften wie der „Grünen Post“ und der „Berliner Illustrierten“, deren Erträge die „Vossische“ mitfinanzierte
Von Berlins ältester Zeitung fiel ein Glanz auf den ganzen Konzern. „Tante Voß“ gehörte nun mal zu Berlin wie das Brandenburger Tor. Sie hatte den Aufstieg von der verschlafenen Kurfürstenresidenz zur schnelllebigen Millionenmetropole begleitet, sie hatte Könige, Kaiser und eine Revolution überlebt. Und nun sollte plötzlich Schluss sein? Eine geschockte Leserin erzählt in der letzten Ausgabe, wie ihr die Zeitung 1878 eine neue Welt erschloss: „Wenn der Vater nach der Sprechstunde auf dem Balkon mit seiner Weiße bei der dickleibigen Vossischen Zeitung saß, kam man heran und fragte: ,Vater, was bedeutet der Buchstabe? Was bedeutet jener? Was liest du denn da so eifrig?‛ Man wollte wissen, man war neugierig. Das Zusammenziehen der Buchstaben kam ganz von selber. So habe ich in der Vossischen Zeitung lesen gelernt.“
Stolz führte die „Vossische“ bis zuletzt den Preußenadler und ihren alten Namen im Zeitungskopf: „Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen, gegründet 1704“. Zeitungsforscher wie Holger Wettingfeld vom Deutschen Pressemuseum glauben, dass ihre Geschichte in Berlin sogar bis ins Jahr 1617 zurückreicht.
Der Name „Vossische“ geht auf den Buchhändler Christian Friedrich Voß zurück, der das Blatt 1751 übernahm. Voß engagierte Lessing als Rezensenten, später den Aufklärer Karl Philipp Moritz als Redakteur. Im 19. Jahrhundert setzten Ludwig Rellstab, Willibald Alexis und Ludwig Pietzsch literarische Maßstäbe, als Theaterkritiker verdiente Theodor Fontane 20 Jahre lang seine Brötchen bei „Tante Voß“. Bis kurz vor der Übernahme durch die Ullsteins blieb die Zeitung im Besitz der Familie Lessing, was auf die Heirat einer Tochter von Voß mit einem Bruder des Dichters zurückging.
In den Ullsteinjahren ist die Zeitung bürgerlich-liberal, republiktreu und setzt sich für die deutsch-französische Aussöhnung ein, sie findet aber unter dem umtriebigen Chefredakteur Moritz Goldstein keine so klare politische Linie wie das von Theodor Wolff geleitete „Berliner Tageblatt“. Das Feuilleton, geleitet von Monty Jacobs, liest man heute noch mit Vergnügen – und Wehmut. Genau wie die klugen Gerichtsreportagen des früh verstorbenen Paul Schlesinger, alias Sling, der 1927 den „Geist des Hauses“ einfing:
„Wir wissen, es gibt Schweres, Unlösbares. Aber wir glauben, das Schwere kann in eine verständliche Form gebracht werden. Ein Witz kann tiefer leuchten als die gelehrteste Abhandlung. Wir gucken alle nach einer plötzlichen, blitzartigen Erhellung. Das macht unsere Arbeit lustvoll, lustig.“ Austausch und Rivalität der vielen Redaktionen im Ullsteingebäude spornen an: „Jeder muss an seiner Stelle produktiv sein. Der Mensch, der sich hinsetzt, denkt wohl, er mache seine Acht-Stunden-Arbeit und könne dann befriedigt nach Haus gehen; aber er merkt plötzlich, dass er nicht mehr sitzt. Der Stuhl ist unter ihm weggezogen. Er hat das Haus nicht verstanden; es ist ein Haus zum Denken und Handeln, nicht zum Sitzen.“

1926/27 bauten die Ullsteins im Tempelhof ein neues Druckhaus in Tempelhof, weil Platz und Druckkapazitäten im Zeitungsviertel nicht mehr ausreichten. Die expressionistische Backsteinburg war auch ein Symbol für die Aufbruchstimmung im Berlin der „goldenen“ Zwanzigerjahre zwischen Inflation und Weltiwrtschaftskrise. Die „Vossische“ indes wurde noch bis 1934 an der Kochstraße 22-26 redigiert, gesetzt und gedruckt – dort, wo heute der „Rocket-Tower“ (das ehermalige GSW-Hochhaus) an der Rudi-Dutschke-Straße steht, zwischen Springer und „taz“.
In der anregenden Atmosphäre der späten Zwanzigerjahre blüht „Tante Voss“ auf. Und sie bekennt Farbe. „Wählt republikanisch! Wählt Fortschritt, nicht Umsturz! Wählt Deutsche, nicht Fanatiker! Wählt Führer, nicht Verführer! Wählt! Wählt!“ steht in großen Lettern auf der Ausgabe zur Reichstagswahl im September 1930. Es hilft nichts, die Nationalsozialisten steigen von einer Splitterpartei zur zweitstärksten Kraft im Reichstag auf. Die antisemitische Propaganda gegen die „Rotations-Synagogen“ des Ullsteinkonzerns wird immer lauter und verunsichert die fünf Söhne des Verlagsgründers. Die Chefs sind uneins, wie sie auf den Rechtsruck reagieren sollen. Statt ihre Medienmacht gegen die Feinde der Republik zu wenden, setzen sie auf parteipolitische Neutralität. „An sich sind uns die Nazis als Leser und Inserenten erwünscht“, sagt einer der Ullsteinchefs dem republikanischen Autor Heinrich Mann ins Gesicht.
Ab 1931 verdampft der „Geist des Hauses“. Der Verlag kündigt profilierten linken Autoren wie Kurt Tucholsky und Heinz Pol die Mitarbeit. In der „Weltbühne“ spottet Carl von Ossietzky: „Bei Ullsteins heißt das Ideal: ein Völkischer Beobachter mit der Genehmigung des Rabbinats, und auch von den Kommunisten gerne gekauft; ein Bastard von Goebbels und der Tante Voß. Da sich dieses bizarre Verlagsideal nicht leicht verwirklichen lässt, behilft man sich mit einem reichlich chimärischen ,innern Gleichgewicht’; man dämpft, man retuschiert, man untersagt der ,Voß’ etwa den Gebrauch des Wortes Nazi, ,um die Leute nicht unnötig zu reizen’. Und bei dieser Taktik werden die Blätter immer langweiliger und ein immer schlechteres Geschäft.“
Die Nationalsozialisten agitieren heftig gegen den angeblich jüdischen Ullstein-Konzern, der so viel erfolgreicher ist als ihre eigenen Verlage. Ihr Ziel ist jedoch nicht die Zerschlagung, sondern die feindliche Übernahme. Als Hitler Reichskanzler wird, zeigt sich, dass das Ullsteinhaus längst von einer nationalsozialistischen Betriebszelle unterwandert ist. Von innen und außen wächst der Druck, bewährte Mitarbeiter durch Anhänger des Regimes zu ersetzen. Im Juni 1934 kapituliert die Eigentümerfamilie: Für 6 Millionen Reichsmark in bar, ein Zehntel des tatsächlichen Wertes, verkauft sie das Unternehmen an ein Konsortium um die Deutsche Bank und den nationalsozialistischen Franz Eher Verlag. Unter dem Namen „Deutscher Verlag“ erwirtschaftet der arisierte Medienkonzern bis 1945 einen Gewinn von 162 Millionen Reichsmark.
„Tante Voß“ stirbt rechtzeitig, um ihren guten Ruf zu retten.

Erstdruck: Der Tagesspiegel vom 30. April 2014 / aktualisiert Februar 2024